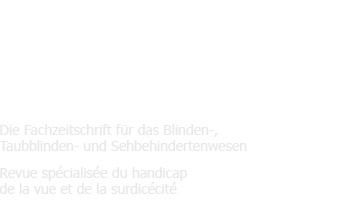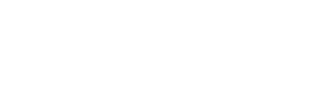Zwischen Autonomie und Herausforderung: Wie sehbeeinträchtigte junge Erwachsene ihren Weg finden

Sehbeeinträchtigte junge Erwachsene stehen oft vor besonderen Herausforderungen, wenn sie ins Berufs- und Erwachsenenleben starten. Eine neue Vorstudie im Auftrag des SZBLIND untersucht, wie sie ihre Autonomie stärken und ihre Ressourcen nutzen können. Warum Forschung und Praxis dringend mehr Antworten brauchen – und was bereits getan wird.
Von Michel Bossart, Redaktion tactuel
Was weiss die Wissenschaft eigentlich über das Wohlbefinden junger Erwachsener zwischen 18 und 35 Jahren? Vivianne Visschers, Verantwortliche Forschung beim SZBLIND, sagt: «In der Schule und in der Ausbildung werden junge sehbeeinträchtigte Menschen begleitet und auf das Leben vorbereitet. Nach Abschluss der Ausbildung fallen sie aber aus dem System und müssen sich alleine zurechtfinden. Obwohl verschiedene Beratungsstellen zur Verfügung stehen, nehmen nur wenige junge Erwachsene diese in Anspruch. Das kann zum einen bedeuten, dass die Jugendlichen sehr gut alleine zurechtkommen, zum anderen, dass sie das Beratungsangebot nicht kennen oder es ihnen keinen Mehrwert bietet.»
Visschers vertiefte sich in die Forschungsliteratur und war ernüchtert: Die jüngste Schweizer Studie, die sich mit dieser Frage beschäftigt, stammt aus dem Jahr 2008 (Ursula Hofer, «Bedeutung institutioneller Bildungsangebote für die berufliche und soziale Integration sehgeschädigter junger Erwachsener»). «Hofer hat damals schon einige Problemfelder aufgezeigt, aber ich weiss ehrlich gesagt nicht, was aus den gewonnenen Erkenntnissen gemacht wurde», sagt Visschers. Sie vertiefte sich weiter in die Forschungsliteratur – vor allem im internationalen Umfeld – und diskutierte ihre Befunde in einem Netzwerk von Schweizer Forschenden.
Zusammenarbeit mit der FHNW
In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz wurden fünf Forschungsfelder rund um junge Erwachsene mit Sehbeeinträchtigung identifiziert, die fünf Studierende im Rahmen einer kleinen Studie vertieft haben: Psychisches Wohlbefinden, Arbeit/Karriere, Soziale Integration, Partnerschaft und Elternschaft sowie Interventionen. «Das zentrale Ergebnis dieser Vertiefungen war die Bedeutung von Autonomie und Unabhängigkeit für junge Erwachsene», erklärt Visschers. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass im Vergleich zu sehenden Jugendlichen die psychische Entwicklung bei sehbeeinträchtigten Jugendlichen etwas verzögert ist. «Das ist eigentlich nicht verwunderlich, denn sehende Jugendliche können sich in der Pubertät leichter von den Eltern lösen als sehbeeinträchtigte.» Letztere bleiben nämlich in vielen Dingen auf die Hilfe ihrer Umgebung angewiesen: zum Beispiel, um von A nach B zu kommen, oder um überhaupt an Informationen zu gelangen. Die Beziehung zu den Eltern bleibt also auch im Erwachsenenleben sehr wichtig. «Der Freundeskreis sehbeeinträchtigter Jugendlicher scheint nicht so stabil wie der ihrer sehenden Altersgenossen zu sein», sagt Visschers. Zum einen sei das soziale Umfeld gerade wegen der Beeinträchtigung ohnehin schon kleiner, zum anderen verlören sehbeeinträchtigte junge Erwachsene nach dem Schulabschluss viel schneller den Kontakt zu ihren sehenden ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern. «Sie sind auf ihre Eltern und Geschwister angewiesen. Das kann dann zum Problem werden, wenn die Eltern diese Unterstützung nicht mehr bieten können oder wenn die Geschwister eine eigene Familie gründen und zum Beispiel wegziehen», erklärt Visschers.

Nächster Schritt: Interviews mit Betroffenen
Das ist ein zentrales Thema dieser Vorstudie. «Ich bin gespannt, was die Studierenden in der Interviewphase herausfinden», sagt Visschers. Die fünf Studierenden sind im dritten Semester ihres Bachelorstudiums in Angewandter Psychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Im Januar und Februar interviewten sie Betroffene anhand eines selbst entwickelten Leitfadens, der auf den Erkenntnissen der Literaturrecherche basiert. «Es handelt sich um qualitative Forschung: Ich erwarte, dass alle Problemfelder angesprochen und beleuchtet werden. Rein statistische Aussagen wird man danach aber nicht ableiten können», dämpft Visschers mögliche Erwartungen gleich im Vorfeld. «Die Studierenden haben dafür den Fokus auf die Ressourcen gelegt», erklärt Visschers und meint damit, dass das Selbstvertrauen steigt, wenn man einmal gelernt hat, wie man mit einer bestimmten Situation umgehen kann und diese auch schon erfolgreich gemeistert hat. Ressourcen schaffen Selbstvertrauen. Die Studierenden sollen herausfinden, wie junge Erwachsene mit Sehbeeinträchtigung bereits vorhandene Ressourcen auch zur Bewältigung anderer Probleme einsetzen können.
Die Studierenden werden ihre Erkenntnisse in einer benoteten Projektarbeit festhalten und präsentieren. «Ich rechne damit, dass sie auch Handlungsempfehlungen formulieren», sagt sie. Braucht es zum Beispiel mehr Aufklärung? Muss das Angebot der Beratungsstellen diversifiziert werden? Visschers kann sich auch vorstellen, dass die Studierenden vorschlagen, eine vertiefende Studie zu einem bestimmten Thema durchzuführen. Dass Handlungsbedarf besteht, steht für Visschers fest. Vielleicht soll die Autonomie junger Erwachsener mehr gefördert werden. Autonomie ist ein wichtiger Begriff. Die Betroffenen sollen auf jeden Fall selbst entscheiden, aber auch wissen, wie und bei wem sie sich bei der Umsetzung Hilfe holen können.
Wichtige Ressourcen
Statistisch gesehen sind viele junge Menschen mit Sehbeeinträchtigung auch von einer kognitiven Beeinträchtigung betroffen. Auf diese konzentriert sich diese Studie leider nicht. Visschers meint dazu: «In einer möglichen Folgestudie müssen wir diese Gruppe auf jeden Fall miteinbeziehen.» Vorerst gehe es aber darum, mit dieser Vorstudie zu verwertbaren Erkenntnissen zu kommen. Bis Visschers die Resultate präsentieren kann, dauert es voraussichtlich noch bis Juni dieses Jahres. Ob sich daraus dann ein grösseres vom SZBLIND getragenes Forschungsprojekt entwickelt, wird sich zeigen.