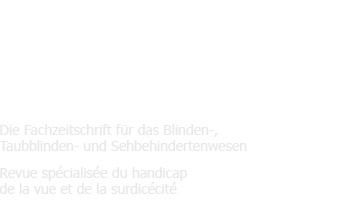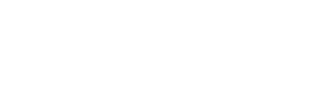Verborgene Sehstörungen: Warum man genau hinschauen muss

Iris Reckert ist Orthoptistin und Expertin für neurovisuelle Störungen. In ihrem Buch «Sehen findet im Gehirn statt» beschreibt sie, wie neurologische Erkrankungen das Sehvermögen beeinflussen. Im Interview spricht sie über die Herausforderungen bei der Diagnose von Sehstörungen und warum das Zusammenspiel von Neurologie und Augenheilkunde entscheidend ist.
Von Michel Bossart
Iris Reckert ist Orthoptistin und Erwachsenenbildnerin. Ab 1995 war sie massgeblich am Aufbau des Therapieschwerpunkts Orthoptik in der Neurorehabilitation und der Diagnostik und Therapie bei neurovisuellen Störungen an der Rehaklinik in Zihlschlacht beteiligt. Im vergangenen Jahr hat sie die Erkenntnisse ihrer langjährigen Erfahrung in einem Buch («Sehen findet im Gehirn statt») niedergeschrieben. Das Buch ist ein orthoptischer Leitfaden für die Rehabilitation von Menschen mit Hirnverletzungen. Da sich neurologische Erkrankungen oft auch auf das Sehvermögen auswirken, sprach «tactuel» mit der Autorin über oft unerkannte Sehstörungen.

Frau Reckert, wie häufig sind Sehstörungen bei neurologischen Erkrankungen?
Die einfache Antwort ist: häufig. Es ist schwierig, eine genaue Zahl zu nennen. Wir müssen davon ausgehen, dass 25 bis 30 Prozent aller neurologischen Erkrankungen auch zu Sehstörungen führen. Bei Schädelhirntraumata kann die Zahl auch höher liegen. 50 Prozent halte ich hier für realistisch. Klar ist: Sehstörungen sind keine Seltenheit.
Bei welchen Erkrankungen treten sie denn besonders häufig auf?
Bei einem Schlaganfall kommt es auf das betroffene Versorgungsgebiet im Gehirn an. Ist das hintere Versorgungsgebiet oder die Sehbahn betroffen, wirkt sich das auf das Gesichtsfeld aus. Bei einer Schädigung des Hirnstamms ist eher die Augenbeweglichkeit betroffen. Bei einem Schädelhirntrauma treten Sehstörungen durch Scherverletzungen auf (Anm. d. Red: Kräfte, die auf Körpergewebe wirken, wobei dieses in verschiedene Richtungen auseinandergezogen wird): Die Augenbeweglichkeit ist eingeschränkt und Doppelbilder entstehen.
Und bei welchen Erkrankungen werden Sehstörungen besonders häufig nicht erkannt?
Es sind die Symptome, nicht die Krankheit, die nicht erkannt werden. Ich halte es mit Einstein, der sagte: «Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können.» Er meint damit: Haben wir kein theoretisches Konzept, können wir Symptome nicht erkennen, nicht darauf achten und sie nicht interpretieren. Ausserdem gibt es Sehstörungen, die wir nicht einfach beobachten können, weil sie nur mit technischen Hilfsmitteln erkennbar sind.
Zum Beispiel?
Neurologen wissen zwar, dass hintere Infarkte zu partiellen Gesichtsfeldstörungen führen können. Diese sind aber mit groben Screeningmethoden nicht erkennbar, man muss schon genau untersuchen. Skotome, also inselförmige Gesichtsfeldausfälle, stören Patienten stark und können etwa die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Ein anderes Beispiel sind Störungen der Okulomotorik: Wenn der Schielwinkel nicht zu gross ist, ist er mit blossem Auge nicht zu erkennen.
Welchen Beitrag können Patienten leisten, damit Sehstörungen richtig diagnostiziert werden können?
Das Problem ist, dass neurologische Patienten oft nicht in der Lage sind, adäquate Informationen zu geben. Nach einer Hirnverletzung geht es ihnen meist sehr schlecht und sie sind sich ihrer Krankheit nicht bewusst. Die Symptome sind zwar da, werden aber nicht mitgeteilt.
Sie haben ein Buch geschrieben: «Sehen findet im Gehirn statt». Dieses ist letztes Jahr erschienen. Wie kam es dazu und wie ist die Resonanz?
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass Orthoptik, Augenheilkunde und Neurologie nicht gut vernetzt sind. Die Neurologie versteht wenig vom Auge, der Augenarzt ist kein Neurologe. Ich dachte, ein Buch könnte helfen, diese Schnittstellen zu beleuchten. Ich habe dann einen guten Verlag gefunden, der Interesse an dem Projekt hatte, und auch mein Arbeitgeber hat mir günstige Schreibbedingungen geboten. 2023 ist das Buch erschienen und wurde erfreulich gut aufgenommen. Es wurde in Fachzeitschriften besprochen, und ich bekomme auch positive Rückmeldungen aus der Leserschaft. Derzeit überlegt der Verlag, ob es auch eine englische Version des Buches geben soll…
An wen richtet sich Ihr Buch?
Es ist für niemanden genau richtig. Es richtet sich an alle Berufsgruppen, die mit neurologischen Patienten zu tun haben: Pflege, Ärzteschaft, Physiotherapie, Logopädie – alle nehmen sich diejenigen Informationen heraus, die für ihren Bereich wichtig sind.
Im Vorwort sagen Sie, dass es eine Vielzahl sehr unterschiedlicher neurovisueller Symptome gibt. Können Sie trotzdem die häufigsten Symptome nennen?
Ich wehre mich gegen den Begriff «die Sehstörung »: Die Beeinträchtigungen sind sehr, sehr vielfältig. Aber am häufigsten sind sicherlich Gesichtsfeldeinschränkungen. Gefolgt von Augenbewegungsstörungen, Lähmungen und Doppelbildern.
Und welche Symptome sind eher selten und werden oft nicht erkannt?
Probleme mit der Sehschärfe zum Beispiel. Diese treten aus unterschiedlichsten Gründen auf, zum Beispiel, wenn Nerven geschädigt sind oder Blut im Auge ist.
Nehmen wir das Beispiel Parkinson: Mit welchen diagnostischen Hilfsmitteln lassen sich parkinsonspezifische Sehstörungen diagnostizieren?
Das ist ein ganz normaler orthoptischer und augenärztlicher Befund, und es gibt keine Parkinson- spezifischen Diagnoseinstrumente. Aber auch hier gilt Einstein: Die Theorie bestimmt, was man untersucht.
Es gibt jedoch typische Augenbeschwerden beziehungsweise Sehstörungen bei Parkinson-Patienten. Eine davon ist das sehr trockene Auge, aber auch das tränende Auge. Was kann man dagegen tun?
So ist es. Da Parkinson-Patienten oft weniger blinzeln, kommt es zu trockenen Augen. Paradoxerweise können die Augen aber auch tränen. Das liegt daran, dass durch das trockene Auge die Qualität der Tränenflüssigkeit nicht stimmt. Das Auge produziert immer mehr Flüssigkeit, bis es überläuft. Das Rezept: Die Augen regelmässig und oft mit Tränenersatzmitteln befeuchten und aktiv blinzeln.
Was ist zu tun, wenn Betroffene manchmal oder immer doppelt sehen?
Menschen mit Morbus Parkinson haben oft eine starre Körperhaltung und ein starres Blickverhalten. Sie schauen nach oben, starren und blinzeln nicht. Auf diese Weise können latente Schielstellungen dekompensieren und es kommt zu Doppelbildern. Mein Tipp: Viel blinzeln, die Augen hin und her bewegen – dann korrigiert sich das Doppeltsehen oft von selbst.
Parkinson kann auch Halluzinationen auslösen. Wie geht man damit um?
Halluzinationen können unter Medikamenten auftreten und sind gar nicht so selten. Man muss den Patienten klarmachen, dass sie kein psychiatrisches Problem haben. Ein offener Umgang mit dem Thema ist angezeigt.
Werden alle Parkinsonpatienten systematisch auf Sehstörungen abgeklärt? Oder in welchen Fällen ist keine Abklärung angezeigt?
Das Verhalten ist auch in der Normalbevölkerung unterschiedlich: Manche gehen regelmässig zum Augenarzt, andere nicht. Ich denke, gerade im höheren Alter sind regelmässige Augenuntersuchungen sinnvoll. Sie sind ja auch nicht so aufwändig wie zum Beispiel eine Darmspiegelung…
Wie haben sich die diagnostischen Möglichkeiten in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es neue technische Fortschritte, die helfen, neurologische Erkrankungen schneller oder genauer zu erkennen?
Im Vergleich zu vor 30 Jahren erfolgt die neurologische Akutbehandlung heute viel schneller und in spezialisierten Stroke Units. Durch diese rasche Behandlung können die Schäden nach einem Hirnschlag deutlich reduziert werden. Sehr hilfreich und relativ neu in der Augenheilkunde sind Netzhautuntersuchungen mit OCT (Red.: Optische Kohärenztomographie), ansonsten gibt es in der Orthoptik nichts grundlegend Neues. Ich betone noch einmal: Man muss wissen, wonach man sucht. Die diagnostischen Verfahren sind gut etabliert, man muss sie nur richtig anwenden.
Welche Rolle spielen bildgebende Verfahren wie MRT oder CT bei der Diagnose von neurovisuellen Störungen im Vergleich zu rein augenärztlichen Untersuchungen?
Beides ergänzt sich. Bildgebende Verfahren sind wichtig, um eine mögliche Schädigung des Gehirns zu diagnostizieren. Augenärzte, die eine akute Sehstörung feststellen, erkennen oft, dass es sich um eine Hirnschädigung handeln muss, und überweisen die Patienten in die Neurologie.
Gerade weil viele Sehstörungen subtil sind, werden sie oft übersehen. Gibt es Screening-Methoden, die Ärztinnen und Ärzten helfen können, auch unauffällige Sehstörungen frühzeitig zu erkennen?
Ja: Man muss wissen, wonach man sucht (lacht). Im Ernst: Beispielsweise Gesichtsfeldstörungen sind mit Screeningmethoden nur erkennbar, wenn sie sehr ausgeprägt sind. Diskretere Störungen im zentralen Gesichtsfeld findet man häufig mit dem Amsler-Netz. Bei unklaren visuellen Beschwerden sollte man testen, ob sich die Störung mit einem abgedeckten Auge bessert. Wenn das der Fall ist, ist das ein deutlicher Hinweis auf ein Augenstellungsproblem.
Kann man durch regelmässige Kontrollen, zum Beispiel mittels optischer Kohärenztomografie (OCT) oder anderen Tests, bestimmte Sehstörungen bei neurologischen Erkrankungen frühzeitig erkennen oder sogar verhindern?
Nein, nicht verhindern. Die augenärztliche Untersuchung kann aber Aufschluss über die Gefässsituation und somit ein Schlaganfallrisiko geben. Auch bei langsam wachsenden Tumoren können Auffälligkeiten im OCT tatsächlich früh Hinweise geben. Deshalb: Es ist sicher sinnvoll, sich regelmässig augenärztlich untersuchen zu lassen.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Das Auge ist Ihr Beruf. Was ist es, das Sie an diesem Doppelorgan so fasziniert?
Mein Vorname ist Iris: Die Augenheilkunde wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt (lacht). Und dann ist es die Vielfalt der visuellen Wahrnehmungsstörungen, die mich fasziniert: Augenheilkunde und Orthoptik haben mit Sinnesphysiologie zu tun. Da laufen komplexe Prozesse ab, die aufeinander abgestimmt sind. Langweilig ist es mir in meinem Beruf noch nie geworden.