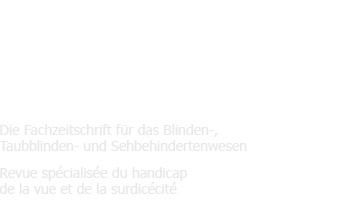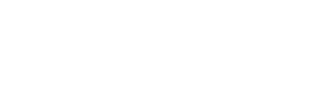Im dümmsten Moment fiel die Kamera aus
Cybathlon 2024

Im Wettkampf trifft Technologie auf Alltag: Beim Cybathlon 2024 ging es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern vor allem um Innovation. Mit ihrem System zur Sehassistenz trat das Schweizer Team «Sight Guide» in der Kategorie VIS an und sicherte sich den dritten Platz – trotz technischer Rückschläge. Doch wie viel alltagstaugliche Zukunft steckt in solchen Wettbewerben? Anni Kern, Co-Direktorin Cybathlon, nimmt dazu Stellung.
Von Michel Bossart, Redaktion tactuel
Wo sonst die Eishockeyprofis des EHC Kloten dem Puck hinterherjagen, machten sich Ende Oktober 2024 Menschen mit einer Beeinträchtigung auf die Jagd nach möglichst vielen Punkten. Am Schluefweg wurde ein Parcours mit zehn Stationen aufgebaut, den es so rasch und fehlerfrei als möglich zu absolvieren galt. Alexander Wyss von der ZHAW, Ingenieur und Doktorand, war für das Team «Sight Guide» verantwortlich. Der Cybathlon findet alle vier Jahre statt. Dies war die dritte Ausgabe, und zum ersten Mal gab es auch einen Wettbewerb für Sehbeeinträchtigte.
Der Cybathlon ist ein Non-Profit-Projekt der ETH Zürich und versteht sich als Plattform, die Entwicklerteams aus aller Welt herausfordert, alltagstaugliche Assistenztechnologien mit und für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln. An einem Wettkampftag stellen sich Teams von Universitäten, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen mit ihren neuen Assistenztechnologien verschiedenen Alltagsaufgaben.
«Mein blinder Professor hatte die Idee, mit der ETH und der Universität Zürich ein Sehteam zu bilden und am Cybathlon teilzunehmen», erzählt Wyss. Es sei sehr bereichernd gewesen, dass so viel Know-how aus drei verschiedenen Forschungsstätten zusammengekommen sei. Schnell war auch ein Pilot mit Sehbeeinträchtigung gefunden, der für das Team ins Rennen ging: Lukas Hendry. Der Freiburger ist ein ehemaliger Weitspringer mit Paralympics-Erfahrung und war schon früh in die Entwicklung der Zürcher Sehassistenz involviert.
Hightech im Gstältli
Die Sehassistenz, mit der das Schweizer Team angetreten ist, ist technisch zwar ausgeklügelt, aber alltagstauglich ist sie nicht gerade. Es handelt sich um ein System, das im Wesentlichen aus zwei Kameras und einem Computer besteht. Der Pilot trägt es auf dem Rücken und am Bauch in einer Art militärischen Grundtrageeinheit, dem «Gstältli ». Das System analysiert die Umgebung, erkennt verschiedene Hindernisse in der Umgebung und gibt dem Piloten über Audio- oder Vibrationssignale Informationen, wie er sich verhalten muss, um die Aufgabe erfolgreich zu lösen. «Es war nie unser Anspruch, etwas wirklich Alltagstaugliches zu bauen», beginnt Wyss zu erklären. «Vielmehr ging es uns als Ingenieure und Forscher darum, Techniken zu entwickeln, die das Interesse potenzieller Start-ups wecken könnten, die sie dann zur Marktreife weiterentwickeln.»
«Zuerst haben wir uns überlegt, wie wir ein gestelltes Problem technisch lösen könnten, und dann haben wir mit unserem Piloten darüber gesprochen », fährt er fort. Nachdem Hendry grünes Licht gegeben hatte, machte sich das Team an die technische Umsetzung, die vom Piloten immer wieder auf ihre Tauglichkeit getestet wurde.
Hindernisse und Taktik
Zurück zum Cybathlon-Wochenende Ende Oktober 2024: Der Parcours, der für das Sehassistenzrennen aufgebaut wurde, bestand aus zehn Stationen. An der ersten Station musste der Pilot ein Getränk servieren und einen Teller Suppe tragen, ohne etwas zu verschütten. An der zweiten musste er den richtigen Namen auf einer Türklingel finden und klingeln. Weitere Herausforderungen bestanden darin, freie Sitzplätze zu finden, beim Einkaufen bestimmte Artikel im Regal zu finden oder einen Raum zu durchqueren, ohne gegen Gegenstände zu stossen. Bei der sechsten Station ging es darum, bestimmte Gegenstände wie eine heruntergefallene Gabel in einer Gruppe zu identifizieren. Dann galt es, einem schmalen Weg zu folgen, ohne ihn zu verlassen, verschiedene Farben und Farbtöne zu erkennen, einen Touchscreen zu bedienen und ein bestimmtes Produkt zu bestellen.
Keinen Nuller riskieren
Der Pilot musste die gestellte Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen, dann gab es 10 Punkte. Schon bei kleinen Fehlern gab es gar keinen Punkt. «Aus taktischen Gründen haben wir uns entschieden, Pilot Hendry nur acht der zehn Aufgaben ausführen zu lassen», sagt Wyss, betont aber, dass sie die technischen Lösungen für alle zehn Aufgaben gehabt hätten. «Die Station, bei der der Pilot einem schmalen Pfad folgen musste, haben wir ausgelassen. Ebenso die Aufgabe, bei der er bestimmte Gegenstände vom Boden aufheben musste.» Hier war die Fehleranfälligkeit gross und die Zeit ein entscheidender Faktor. Einen Nuller wollte man nicht riskieren. «Am Schluss gewinnt derjenige mit den meisten Punkten und nicht derjenige mit der besten Technik», fasst Wyss zusammen.
10 Teams traten in der Kategorie «VIS» an. Das Schweizer Team erreichte mit 20 Punkten den 3. Platz hinter den Teams aus Frankreich (30 Punkte) und Ungarn (70 Punkte). Und das, obwohl die Schweizer nach der Qualifikationsrunde noch mit 70 Punkten klar geführt hatten. Wyss relativiert: «Der Cybathlon ist nicht mit einem Champions- League-Spiel zu vergleichen, bei dem das Verliererteam bittere Tränen weint. Am Schluss gratulierten sich die Teams gegenseitig und erkundigten sich, wie sie dieses oder jenes Problem technisch gelöst hatten. «Der Austausch zwischen allen Forschern, Ingenieuren und Piloten ist immer konstruktiv und freundschaftlich.»
Wenn die Technik streikt
Wyss bedauert, dass ausgerechnet im Finale die Hauptkamera ausfiel und eine noch bessere Platzierung verhinderte. «Im Training hatten wir oft mit technischen Problemen zu kämpfen, hatten ein gutes Errorhandling und konnten schnell Lösungen finden. Der Kameraausfall kam einfach zum ungünstigsten Zeitpunkt». Dennoch kann das Team stolz auf sich sein: Neben dem Podiumsplatz erhielt es von einer interdisziplinären Jury den «Innovation & Usability Award» und eine Auszeichnung für die Höchstpunktzahl von 70 Punkten über alle Rennen hinweg und für Zeitrekorde bei vier Aufgaben.
Eine erneute Teilnahme von «Sight Guide» am Cybathlon in vier Jahren ist kaum zu erwarten. «Wir gehen alle unseren eigenen Weg: Der eine oder andere beendet sein Studium und macht Platz für nachfolgende Forscher und Ingenieurinnen. Das ist gut und richtig so», meint Wyss.
Cybathlon steht für eine Welt ohne Barrieren. Doch wie gelingt der Transfer vom Wettbewerb in die Praxis?
Fünf Fragen an Anni Kern, Co-Direktorin Cybathlon
Wie stellen Sie sicher, dass die im Cybathlon entwickelten Technologien tatsächlich den Bedürfnissen blinder Menschen entsprechen?
Dies geschieht gemeinsam mit den teilnehmenden Teams. Wir veröffentlichen das Regelwerk und die Aufgaben rund drei Jahre vor dem Hauptanlass. Erste Teams stellen früh Rückfragen und geben uns Hinweise, wie man die Aufgabe zum noch besseren Alltagstest machen könnte. Beim Entwickeln der Aufgaben tauschen wir uns als erstes mit den Anwenderinnen und Anwendern aus, also mit den Menschen mit Beeinträchtigung. Es ist aber klar, dass wir den Alltag in den Aufgaben nicht immer zu hundert Prozent widerspiegeln können. Manchmal gibt es tatsächlich Ansätze, die sehr spezifisch für den Punktgewinn im Wettkampf sind – aber auch solche Ansätze können spannend für Weiterentwicklungen sein.
Sehen Sie die Gefahr, dass solche Wettbewerbe mehr auf den Show-Effekt setzen, als Lösungen zu fördern, die langfristig und breit anwendbar sind?
Im akademischen Umfeld gibt es viele «Wettbewerbe », die an Lösungen interessiert sind. In der Schweiz veranstalten beispielsweise Gruppen von Studierenden sogenannte Hackathons, bei denen sie individuelle Lösungen für Menschen mit Behinderungen an einem Wochenende entwickeln. Der Sinn des Cybathlon ist es gerade, den «Show- Effekt», wie Sie es nennen, zu nutzen, um gute Lösungen zu fördern. Jedes Team, dass beim Cybathlon mitmacht, steht in der Öffentlichkeit, die Mensch-Maschinen-Interaktion muss punktgenau und zuverlässig funktionieren. Als Nebeneffekt informiert und sensibilisiert der Cybathlon, wie auch Hackathons, Menschen, die nicht mit Technologien oder mit Menschen mit Behinderungen in Berührung kommen. Der ETH Zürich ist es wichtig, mit den Menschen in einen Dialog zu treten und die Chancen und Grenzen von Forschung und Entwicklung aufzuzeigen und über gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren.
Wie gelingt der Brückenschlag zwischen den im Wettbewerb getesteten Prototypen und marktreifen, nutzerfreundlichen Produkten?
Der Cybathlon ist eine Plattform, die internationale Entwicklerteams motiviert, sinnvolle Technologien für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln oder bestehende Technologien zu optimieren und auch zu testen. Ohne unseren Wettkampf würden die Prototypen vielleicht nie getestet, vielleicht nicht einmal mit den Anwendern und Anwenderinnen besprochen. In diesem Fall ist die Chance, dass ein Produkt auf den Markt kommt, gleich null. Ob aus einem Prototyp oder Teilsystem ein Produkt entsteht oder eine Firma eine Idee übernimmt, können wir als Hochschule nicht beeinflussen. Jedoch sind aus dem Cybathlon schon marktreife Geräte entstanden wie zum Beispiel der Schweizer Rollstuhl Scewo.
Blinde Menschen sind heterogen in ihren Bedürfnissen – wie adressieren die Technologien die Vielfalt innerhalb dieser Gruppe?
Der Cybathlon versucht die Inklusionskriterien für die Technologie sowie für die Behinderung so breit und allgemein wie möglich zu halten. So sind die Entwicklerteams weniger eingeschränkt in ihren Innovationen. Natürlich werden die Geräte zusammen mit den Piloten entwickelt, das heisst, der Prototyp ist auf die Bedürfnisse dieser einen Person zugeschnitten. User-centered Design ist gleichzeitig auch absolut notwendig, um überhaupt sinnvolle Geräte zu entwickeln. Ohne Iterationen mit den Nutzerinnen entsteht kaum ein alltagstaugliches Assistenzsystem.
Was ist für Sie der grösste Mehrwert solcher Veranstaltungen: die technische Innovation oder die gesellschaftliche Sensibilisierung für die Lebensrealität beeinträchtigter Menschen?
Ich denke, es ist das Zusammenspiel der beiden Dinge. Die Faszination für neue Technologien und wie sie Menschen im Alltag unterstützen können, ist augenöffnend für die Studierenden, das Publikum, aber auch für Nutzende der Systeme selbst.