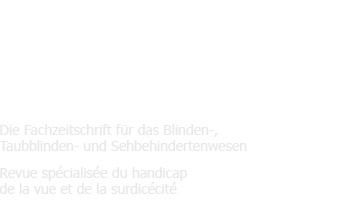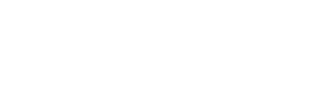„Die Starstecher waren sehr gefragt“
Ein Interview mit Dr. Hubert Steinke, Professor am Institut für Medizingeschichte in Bern
Von Ann-Katrin Gässlein
Herr Prof. Steinke, wann in der Geschichte der Menschheit wurde erstmals ein Grauer Star operiert?
In der Literatur finden wir den ersten Hinweis auf eine Therapie des Grauen Stars im „Codex Hammurapi“, einer babylonischen Sammlung von Rechtssprüchen aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Diese Quelle stammt aus dem antiken Mesopotamien, ist in Keilschrift verfasst, und der entsprechende Hinweis lautet:
„Wenn ein Arzt einen Mann mit einem bronzenen Instrument von einer schweren Wunde geheilt oder das Fleckchen im Auge eines Mannes mit dem bronzenen Instrument geöffnet und das Auge des Mannes geheilt hat, sind ihm dafür zehn Schekel Silber zu bezahlen.“
Das klingt stark nach einem Starstich, auch wenn man das nicht eindeutig sagen kann. Diese Quelle ist fast 4’000 Jahre alt.
Gab es diese Behandlungsform auch in anderen Kulturen?
Im alten Indien wie im alten Griechenland wird die Operation beschrieben. Auf die antike Medizin geht auch der Begriff „Katarakt“ zurück, was übersetzt „Wasserfall“ bedeutet. Der Ausdruck ist der Lehre geschuldet, dass sich alle Körperfunktionen auf das Fliessen von Säften zurückführen lässt. So entstand die Vorstellung einer Trübung des Auges durch Flüssigkeiten, die vom Gehirn ins Auge fliessen. Das war keine korrekte anatomische Vorstellung, aber die Behandlungsmethode des Starstichs war wie schon in Mesopotamien bekannt.
Wann wurde der Starstich in Europa bekannt?
Viele griechische Texte wurden in Europa dank arabischer Übersetzungen erst in der Renaissance bekannt und rezipiert. Die arabischen Schriften beschrieben den Katarakt chirurgisch präzise. Ab dem 13. Und 14. Jahrhundert erlebte Europa einen blühenden Aufschwung in der medizinischen Forschung: Einerseits wurde die Chirurgie wertgeschätzt und der Starstecher zum europaweiten Phänomen – andererseits entwickelte sich die akademische Medizin rasant.
Gehörten Chirurgie und Medizin nicht zusammen?
Typisch für das Mittelalter war die Trennung zwischen akademischer Medizin und handwerklicher Chirurgie. Starstecher machten eine Handwerkslehre. Und natürlich gab es in diesem Bereich unterschiedlichste Figuren; die Übergänge zwischen Scharlatanen und Personen mit hohem technischem Know How waren fliessend. Übrigens gab es auch andere Berufe in der Chirurgie: Blasensteinoperationen wurden von Steinschneidern durchgeführt.
Wie muss man sich einen solchen Starstecher vorstellen?
Die Bevölkerung hatte grosses Interesse daran, dass solche handwerklich ausgebildeten Personen von Zeit zu Zeit vor Ort waren und diese Krankheiten behandeln konnten. Es musste schnell gehen; Schmerzmittel gab es damals nicht, daher waren die Starstecher sehr gefragt. Einen eigenen dauerhaft ansässigen Starstecher oder Steinschneider konnte man sich aber nicht leisten. Also zogen diese Personen von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Sie waren nach den Operationen nicht unbedingt „weg“, weil sie Komplikationen aufgrund mangelhaft durchgeführter Operationen befürchteten, sondern weil das Weiterziehen zu ihrem Broterwerb gehörte.
Wie wurde zu früheren Zeiten der Starstich gemacht?
Sehr lange blieb die Methode nahezu unverändert: Von der Seite stach man mit einem feinen Instrument in den Augapfel und drückte die Linse nach unten. Sie blieb auf dem Grund des Glaskörpers liegen. So erhielt das Auge wieder Licht, aber man hatte keine Sehschärfe und konnte keine Akkommodation machen. Um in der Ferne etwas sehen zu können, brauchte man nach dem Starstich die so genannten Starbrillen mit flaschenbodendicken Gläsern. Trotzdem war der Starstich für die Menschen der damaligen Zeit ein grosser Schritt: ein vergleichsweise unkomplizierter Eingriff, nachdem man endlich wieder wenigstens etwas sehen konnte.
Kam es nicht oft zu Komplikationen?
Je nach Beschaffenheit des Auges konnte die Linse wieder nach oben rutschen oder frei im Auge flottieren. Manchmal ist die gallertartige Masse des Glaskörpers ausgelaufen. Das Risiko einer Infektion war sicher die Hauptgefahr – eine solche konnte zur kompletten irreversiblen Erblindung führen, im schlimmsten Fall sogar zu einer Blutvergiftung.
Gibt es bekannte Fälle für einen solchen Verlauf?
Es wird überliefert, dass Johann Sebastian Bach dieses Schicksal traf. Er wurde von einem damals bekannten Starstecher operiert, erblindete dann ganz und starb wenig später, laut Theorie an eben einer Infektion. Doch genau kann man das nicht sagen.
Wann änderte sich die Methode des Starstichs?
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts probierte der französische Chirurg Jacques Daviel, die Linse herauszunehmen. Diese Methode hatte Vor- und Nachteile: Einerseits befand sich die Linse nicht mehr im Auge und konnte keinen Ärger mehr verursachen, andererseits war ein grösserer Schnitt nötig, und das Risiko für Flüssigkeitsaustritt und Infektionen stieg. Diese Methode setzte gute technische Fertigkeiten voraus. Daviel selbst soll in zehn Jahren 500 Operationen durchgeführt haben, 90 Prozent davon erfolgreich.
Um 1900, als sich die Chirurgie professionalisierte, begann die Zeit der Experimente: Sollte man die ganze Linse entfernen oder nur den (eingetrübten) Kern? Welche Medikamente sollten begleitend zur Operation eingesetzt werden? Jeder entwickelte seine eigene spezielle Vorgehensweise. Doch die Augenärzte waren Einzelkämpfer; bis zum Zweiten Weltkrieg kam man in Sachen Staroperationen nicht viel weiter.
Wie sah der nächste grosse Schritt aus?
Auch hier kennt die Medizingeschichte eine spannende Geschichte: Herold Ridley hatte im Zweiten Weltkrieg Augenverletzungen bei britischen Bomberpiloten erlebt: Diese hatten Stücke von Plexiglas im Auge – und diese wurden vom Auge nicht abgestossen, es kam nicht zu Infektionen. Ridley schloss daraus, dass man aus Plexiglas künstliche Linsen herstellen könne. Zuerst war das Material zu schwer und die Erfolgsraten gering. Dann aber ging es in Riesenschritten vorwärts, denn nun konnte man eine neue Linse einsetzen. Ohne diesen „Zufallsfund“ wäre die weitere Entwicklung der Katarakt-Operation kaum denkbar gewesen.
Besten Dank für das Gespräch.