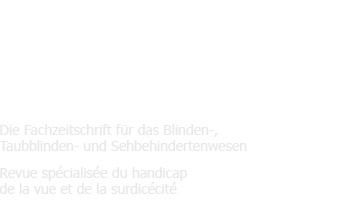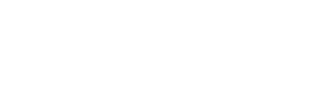Blind mit Kind: Von der Unzulänglichkeit der Welt für sehbeeinträchtigte Erziehungsberechtigte

Tamara De Icco ist alleinerziehende Mutter, blind und steht trotzdem mitten im Leben. Seit 31 Jahren lebt sie mit ihrer Sehbeeinträchtigung und hat gelernt, ihren Alltag kreativ zu meistern. Doch was für andere selbstverständlich scheint, ist für sie oft eine Herausforderung: Ob in der Schule ihrer Tochter oder am Arbeitsplatz – Barrieren und Vorurteile gehören dazu. Wie sie sich davon nicht unterkriegen lässt, erzählt sie mit Offenheit, Witz und einer beeindruckenden Portion Selbstbewusstsein.
Von Michel Bossart, Redaktion tactuel
«Nein», sagt Tamara De Icco bestimmt, «nur weil meine Tochter mich als blindes Mami kennt, heisst das nicht, dass es für sie normal ist.» Die Tatsache, dass alle anderen Kinder eine Mutter haben, die sehen kann, sei nicht zu unterschätzen. Die alleinerziehende Mutter musste ihrer 8-jährigen Tochter die Blindheit in verschiedenen Lebensphasen und Situationen immer wieder neu erklären und verständlich machen. «Für Marie Lou ist die Situation nicht einfach klar, nur weil sie in diese Welt hineingeboren wurde.» Das Thema müsse zwar nicht jeden Tag besprochen werden, aber hin und wieder sei eine vertiefte Auseinandersetzung nötig. «Ich versuche dann immer, auch die positiven Aspekte meiner Sehbeeinträchtigung für sie hervorzuheben», fügt die 35-Jährige aus Münchenbuchsee im Kanton Bern lachend hinzu.
Vom Jobfrust zur Selbstständigkeit
Im Alter von vier Jahren erblindete De Icco nach einer Operation. Sie kann sich zwar noch an Farben erinnern, an ihr Leben ohne Sehbeeinträchtigung hingegen kaum. Nach der Schule absolvierte sie eine kaufmännische Lehre und war zunächst frustriert, weil sie aufgrund ihrer Blindheit keine Arbeit fand, die ihren beruflichen Qualifikationen entsprach. Etwas entmutigt nahm sie dann eine Stelle am Empfang eines Stahlunternehmens an. «Ich arbeitete im Prinzip als Telefonistin, war unterfordert und wenig integriert», erinnert sie sich. Trotzdem blieb sie zehn Jahre: «Ich wurde schwanger, und die Stelle liess sich ideal mit der Mutterschaft vereinbaren: keine belastenden Pendenzen und ein kurzer Arbeitsweg.» Während dieser Zeit liess sie sich nebenberuflich umschulen. «Ich wollte einerseits körperlich arbeiten und andererseits mit Menschen zu tun haben», sagt sie. Nach eineinhalb Jahren berufsbegleitender Weiterbildung machte sie ihren Abschluss als Berufsmasseurin, absolvierte noch 161 Stunden Fortbildung in medizinischen Grundlagen und ist nun von den Krankenkassen anerkannt.
Vor eineinhalb Jahren kündigte De Icco die Empfangsstelle und eröffnete ihre eigene Massagepraxis: «Job, Ausbildung, Haushalt und Kind unter einen Hut zu bringen und nebenbei noch ein eigenes Geschäft aufzubauen, war hart, aber im Nachhinein bin ich stolz, dass ich es geschafft habe!», sagt sie.
Das Geschäft als selbstständige Masseurin läuft noch nicht ganz zufriedenstellend, bedauert sie. Deshalb arbeitet sie noch stundenweise in einer anderen Massagepraxis. «Mit dem Aufbau des Kundenstamms läuft es zwar immer besser, aber sich etwas Eigenes aufzubauen, erfordert mehr als man denkt: Geduld, Zeit und Zuversicht.»
Hindernisse im Schulsystem
Seit Marie Lou in die Schule geht, wird ihr wieder vermehrt vor Augen geführt, wie wenig die Welt für sehbeeinträchtigte Menschen zugänglich ist: «Es gibt Barrieren beim Zugang zu Informationen und bei der Teilhabe», kritisiert De Icco. Das sei manchmal sehr entmutigend: «Wie hoch die Hürden sind, hängt von der Lehrperson und der Institution ab.» Immer wieder für ihr Recht auf Barrierefreiheit zu kämpfen, empfindet sie als ermüdend und frustrierend. Sie nennt ein Beispiel: «Ohne Unterstützung wäre ich bei der Hausaufgabenbetreuung aufgeschmissen. Unser Schulsystem hier funktioniert so, dass die Eltern mithelfen müssen. Ohne meine Assistenzpersonen könnte ich das aber nicht.»
Und bei allem Druck bleibt sie in einem Punkt hart: «Manchmal kommt Marie Lou mit einem Schreiben nach Hause, das ich unterschreiben soll. Grundsätzlich lasse ich mich dazu nicht drängen, sondern unterschreibe nur, was mir eine erwachsene Person vorgelesen hat.» Dabei verlässt sie sich auf ihre Assistenzpersonen – und wenn diese erst am übernächsten Tag wieder einen Einsatz haben, muss die Unterschrift eben warten.
Assistenz und Bürokratie
De Icco erhält von der Invalidenversicherung (IV) einen individuell berechneten Betrag für Assistenzpersonen. Da ihre Tochter nun zur Schule geht, wurde dieser Betrag gekürzt. «Für mich als Alleinerziehende bedeutet die Schulpflicht meiner Tochter nicht unbedingt eine Entlastung: Mit zunehmendem Alter ändern sich zum Beispiel die Hobbys der Kinder und sie müssen anders betreut werden». Die Einsätze der Assistenzpersonen muss sie deshalb genau planen: Für diese ist sie Arbeitgeberin und muss deren Einsätze mit dem von der IV gesprochenen Geld selber abrechnen, Verträge aufsetzen, Sozialversicherungsbeiträge bezahlen oder Lohnabrechnungen erstellen. «Das ist administrativ sehr aufwendig und etwas mühsam, aber so ist es nun mal», meint sie schulterzuckend. Was sie allerdings ein wenig frustriert, ist, dass die IV den Mehraufwand, den sie durch ihre berufliche Selbstständigkeit hat, kaum berücksichtigt: «Es scheint fast so, als ginge die IV davon aus, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht als Selbstständige arbeiten können», sagt sie.
Sag doch hallo
Aussenstehende reagieren unterschiedlich auf De Iccos Blindheit: «Die meisten verfallen in eine Art Schockstarre und fragen sich, wie sie das mit einem Kind schaffen soll, andere äussern Bewunderung. » Ihre Tochter ist inzwischen seit vier Jahren im Schulsystem integriert, doch viele Eltern sind mit der Situation immer noch überfordert. «Obwohl ich ein kommunikativer Mensch bin», sagt sie, «gehe ich nicht mehr alleine an Schulanlässe.» Zu oft sei sie im Getümmel gestanden, und niemand sei auf die Idee gekommen, sie zu fragen, ob sie Unterstützung brauche. Von ihrer Assistenzperson weiss sie, dass die Leute sie lange anschauen und dann einfach weggehen. «Warum sagen sie nicht einfach hallo? Sie kennen mich doch», fragt sie sich.
Normaler Alltag
Morgens braucht De Icco eine halbe Stunde für sich, bevor sie ihre Tochter weckt, schulfertig macht und zur Schule schickt. «Ich stehe dann immer auf dem Balkon und winke ihr nach. Darauf besteht Marie Lou», sagt sie liebevoll. Wenn sie nicht zur Arbeit muss, kümmert sie sich um den Haushalt, kauft ein und kocht das Mittagessen. Am meisten ärgert sie sich, wenn ihr im Haushalt etwas herunterfällt und sie es wieder aufheben muss. «Und der Kleiderschrank meiner Tochter», fügt sie lachend hinzu. «Marie Lou hat einfach keine Ordnung. Wie soll ich da zum Beispiel zu klein gewordene Sachen aussortieren, wenn sie alles falsch einräumt…».
Am Wochenende sind die beiden gerne mit Freunden unterwegs, gehen im Wald spazieren oder in den Tierpark. Wenn De Icco Zeit für sich hat, geht sie mit jemandem von Blind-Jogging laufen, trainiert im Fitnessstudio oder hört ein Hörbuch. Früher hat sie auch gerne getanzt, aber dieses Hobby hat sie jetzt auf Eis gelegt, weil es ihr zeitlich nicht mehr möglich ist.
Den Alltag meistert sie mit den üblichen Hilfsmitteln wie dem Langstock, und sie schwärmt davon, wie das Smartphone sie bei alltäglichen Dingen unterstützt: «Die App ‹Be My Eyes› brauche ich oft, zum Beispiel um mir den Wäscheplan vorlesen zu lassen oder wenn ich vor dem Kleiderschrank stehe und wissen möchte, welche Farbe die Strümpfe haben, die ich anziehen möchte». Zum Lesen von Dokumenten oder Etiketten benutzt sie auch die App ‹Seeing AI›.

Tamara De Icco hat sich einen Berufswunsch erfüllt und sich als Masseurin selbstständig gemacht. / Bild: Tom Hiller
Keine Scheu, um Hilfe zu bitten
Der Blindenhund, den sie hatte, wurde vor drei Jahren pensioniert. Im Moment möchte sie keinen neuen Hund. Sie sagt: «Ja, er hat mir geholfen. Aber ein Hund bedeutet auch Arbeit. Im Moment passt ein Hund, um den ich mich zusätzlich kümmern muss, nicht in mein turbulentes Leben. Und das Haus ist noch sauberer…», fügt sie schmunzelnd hinzu.
Ihre Einkäufe erledigt De Icco entweder mit einer ihrer Assistenzpersonen oder sie geht einfach in den Laden und fragt am Kundendienst, ob ihr jemand helfen könne. «Das klappt meistens sehr gut.» Früher hat sie auch online eingekauft, aber nach einem Update war die App nicht mehr so gut zugänglich und seitdem verzichtet sie fast ganz auf das Online-Shopping.
Mit anderen sehbeeinträchtigten Eltern hat De Icco kaum Kontakt. Spontan fallen ihr zwei andere blinde Mütter ein, die sie kennt, die aber nicht in der Region wohnen. «Das ist schade», findet sie, «der Austausch könnte wertvoll sein. Andererseits hat jede ihr eigenes Leben und ihre eigenen Freunde und Freundinnen.» Auch von einem Netzwerk blinder Eltern weiss sie nichts, nur von einem für Eltern mit sehbeeinträchtigten Kindern. «Ja, so ein Netzwerk wäre vielleicht ganz praktisch. Ich habe mich mit vielen Dingen herumgeschlagen, für die jemand anderes vielleicht eine einfache Lösung zur Hand gehabt hätte…»
Trotzdem: Mit ihrer Offenheit, ihrem Humor und ihren klaren Vorstellungen lebt De Icco vor, wie man den Herausforderungen des Alltags konstruktiv begegnet und seinen Weg trotz Widrigkeiten machen kann.