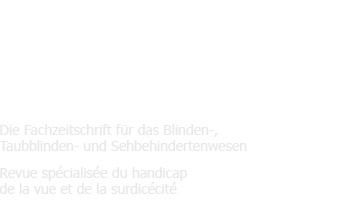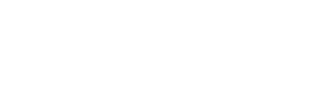Patentlösungen gibt es nicht. Aber das Problem ansprechen, das hilft!
Interview mit Domenica Griesser

Bild: J-Film
Die pensionierte Sozialarbeiterin Domenica Griesser aus St.Gallen hat ein Arbeitsleben lang anderen Menschen mit Sehbeeinträchtigung dabei geholfen, ihre Beeinträchtigung zu akzeptieren und den Umgang mit ihr zu erlernen. Im Interview spricht die 64-Jährige darüber, warum sie diese Arbeit so gerne verrichtete, ob die eigene Behinderung dabei ein Vor- oder Nachteil war und spekuliert über die Gründe, warum Patientinnen und Patienten den Weg in die Beratungsstellen (zu) spät finden.
von Michel Bossart
Frau Griesser, war Ihre eigene Sehbeeinträchtigung ein Vor- oder ein Nachteil für die Sozialarbeit mit blinden und sehbeeinträchtigten Menschen?
Als Sozialarbeiterin war mir in erster Linie wichtig, den Menschen auf eine professionelle Art und Weise zu beraten. Die eigene Betroffenheit kann unter Umständen eine Schlüsselqualifikation sein, ja. In der Tat sahen viele Klienten und Klientinnen darin einen Vorteil, weil sie davon ausgehen konnten, dass ich auch tatsächlich weiss, von was ich spreche. Aber mein Leben ist nicht ihr Leben. Jeder Mensch ist anders und hat eigene Ressourcen, aus denen er schöpfen kann. Meine Aufgabe war, diese Ressourcen zu erkennen und zu fördern.
Waren Sie für andere Betroffene nicht oft eine Art Vorbild?
Klar, ich wurde oft gefragt, wie ich denn diese oder jene Situation selbst gemeistert habe. Und ich habe meine Erfahrungen gerne mit meinen Klientinnen und Klienten geteilt. Mir war aber wichtig, dass meine Art einfach eine Möglichkeit war, wie man mit der Situation umgehen kann. Wir sind alle Individuen und haben unterschiedliche Weisen, wie wir etwas be- und verarbeiten.
War es für Sie selbst ein Vorteil, sehbeeinträchtigt zu sein?
Alles in allem wahrscheinlich ja: Ich habe mich nämlich getraut, auch heisse Eisen anzufassen und Dinge anzusprechen, um die andere vielleicht einen Bogen gemacht haben. Ich habe die Menschen immer direkt angesprochen, auch auf schwierige Themen.
Zum Beispiel?
Beispielsweise, wie sich die Sehbeeinträchtigung auf das unmittelbare Umfeld auswirkt. Gibt es deswegen zwischenmenschliche Probleme? Oder wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Oder im Restaurant: Hat man Angst, dass man von allen beim Essen beobachtet wird? Meidet man gar solche Situationen? Oder umgekehrt: Wird die eigene Beeinträchtigung genutzt, um etwas für sich rauszuholen? Führte sie zu einer Bequemlichkeit? Im Sinne von: Ich probiere es gar nicht erst und lasse das andere für mich erledigen. Ich fand es immer wichtig, diese heiklen Themen anzusprechen und hatte den Eindruck, dass meine Kolleginnen und Kollegen ohne Sehbeeinträchtigung das eher weniger taten.
Was können Sie ganz allgemein über die drängendsten Bedürfnisse Ihrer ehemaligen Klientinnen und Klienten sagen?
Die meisten waren im AHV-Alter und hatten eine Makuladegeneration, aber noch ein vorhandenes Sehpotential. Für diese Personengruppe war es wichtig, dass sie alltägliche Dinge wieder tun konnten. Dinge wie Zeitung lesen, stricken oder die Post selbst bearbeiten. Für einige führten diese eingeschränkten lebenspraktischen Fähigkeiten auch zu depressiven Verstimmungen. Es waren wenige, aber trotzdem. Diese Menschen habe ich durch ihren Trauerprozess begleitet, mit dem Ziel, gemeinsam eine höhere Lebensqualität zu erarbeiten.
Gerade Menschen mit einer altersbedingten Sehbeeinträchtigung suchen oft zu spät Hilfe bei einer Beratungsstelle. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, das stimmt: Das hat wohl damit zu tun, dass sie schlecht informiert werden. In Olten, wo ich arbeitete, gab es viele Augenkliniken und praktizierende Augenärzte. Wir haben versucht, die Ärzteschaft zu uns einzuladen und sie mit unserer Arbeit vertraut zu machen und die Wichtigkeit der Beratungsstelle aufzuzeigen. Einige haben darauf angesprochen, viele aber nicht. Ich kann mich nicht des Eindrucks verwehren, dass viele Ärzte fanden, mit dem medizinischen Teil sei ihre Arbeit getan. Aber eine Sehbeeinträchtigung stellt den ganzen Lebensplan eines betroffenen Menschen auf den Kopf!
Viele kommen dann früher oder später doch in eine Beratungsstelle: Was sind letztendlich die Auslöser, warum Menschen sich Hilfe suchen?
Die Trigger sind sehr unterschiedlich. Häufig ist es, dass sich die Menschen nicht mehr getrauten, das Haus zu verlassen. Oder sie sahen beim Einkaufen die Produkte nicht mehr, konnten ihre Post nicht mehr und schon gar keine Zeitungen oder Heftli lesen. Oft waren sie bereits in augenärztlicher Untersuchung und waren der Meinung, dass man eh nichts machen könne. Und erst, wenn es wirklich nicht mehr ging, haben sie sich auf die Suche nach Hilfe gemacht.
Wann ist denn Ihrer Meinung nach der ideale Zeitpunkt, sich helfen zu lassen?
Den idealen Zeitpunkt gibt es so nicht. Zu Beginn einer altersbedingten Makuladegeneration können viele ja noch Auto fahren und haben keine wesentlichen Einschränkungen in ihrer Lebensqualität. Sobald man aber merkt, dass man in seinen alltäglichen Tätigkeiten eingeschränkt ist, ist es ein guter Moment, das Gespräch mit Beratungsstellen zu suchen. Schon einfache Hilfsmittel wie eine Leselupe oder Filtergläser können dann einen grossen Teil zur Steigerung der Lebensqualität beitragen. Und wenn die Umstände sich dann weiter verschlechtern, hat man schon einen Kontakt und kommt dann wieder für ein Folgegespräch…

Wie sollte man Menschen mit einer beginnenden, altersbedingten Sehbeeinträchtigung ansprechen, um sie zu ermutigen, frühzeitig Beratung in Anspruch zu nehmen?
Auch dafür gibt es leider kein Patentrezept. Wichtig ist, dass man sich als Aussenstehender getraut, das Thema überhaupt anzusprechen. Zum Beispiel so: «Mir ist aufgefallen, dass du die Sachen auf dem Tisch nicht mehr findest oder neben das Glas greifst. Täuscht mich der Eindruck, dass da etwas nicht mehr ganz stimmt?» Dann kann man Hilfe anbieten und beispielsweise fragen, ob man gemeinsam nach Möglichkeiten schaut, die Situation zu verbessern. Ansprechen heisst das Rezept. Man darf aber nicht enttäuscht sein, wenn es erstmal heisst, dass alles in Ordnung sei. Viele Menschen tun sich anfangs schwer damit und versuchen die Beeinträchtigung zu vertuschen und zu verneinen.
Welche Rolle spielen die Augenheilkunde, die Optik und die Sozialarbeit für die Patient Journey einer sehbeeinträchtigten Person?
Wenn die Personen zu uns kommen, haben sie in der Regel schon eine Odyssee hinter sich: waren beim Augenarzt, bei der Optikerin, in der Ergotherapie oder wegen eines Augeninfarkts vielleicht sogar im Notfall. Oft sind sie nicht mehr so einfach bereit, sich nochmal auf etwas Neues einzulassen. Zumal aus medizinischer Sicht nichts mehr gemacht werden kann. Darum ist es wichtig, die betroffene Person und deren Angehörige zu begleiten, auch wenn weitere Stellen oder Fachpersonen einbezogen werden; im Sinne des Casemanagement oder Koordination. Dies ist eine wichtige Aufgabe der Sozialarbeit.
Eine kürzlich durchgeführte Studie hat ergeben, dass nur gerade zwölf Prozent der Patientinnen und Patienten, die von Augenärztinnen und -ärzten an eine Beratungsstelle überwiesen worden sind, dort auch tatsächlich auftauchen. Können Sie sich diese niedrige Zahl erklären?
Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Zahl stimmt. Ein Faktor könnte sein, dass gerade ältere Menschen gar nicht verstehen, was die Augenärztin von ihnen möchte. Sei es, weil sie nicht mehr so gut hören oder weil sie beim Gespräch unter Stress standen und nicht aufnahmefähig waren. Oder man hat ihnen nicht erklärt, welche Unterstützungsmöglichkeiten die Fachstelle anbieten kann und sie wissen gar nicht, wohin sie geschickt werden. Ein anderer Grund könnte die Vermeidungstaktik sein: Der Augenarzt sagt das zwar, aber ich glaub es ihm einfach nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass zur Zeit der Diagnose noch keine wesentlichen Einschränkungen im Alltag vorhanden waren oder schlicht und einfach Scham. Ein weiterer Faktor könnte die fehlende Mobilität sein. Wenn ich niemanden habe, der mich begleitet, dann geh ich auch nicht mehr aus dem Haus. Darum finde ich es grundsätzlich wichtig, dass man solche wichtigen Patientengespräche zu zweit führt. Vier Ohren hören einfach besser als zwei.
Gibt es Momente aus Ihrem Berufsleben, die Sie als besonders erfüllend in Erinnerung behalten?
Ich habe Menschen auf ihrem Weg mit viel Herzblut und Engagement begleitet und fand es immer schön, mitzuerleben, wenn es Menschen gelang, ihre eigenen Ressourcen anzuzapfen und einen guten Umgang mit ihrer Sehbeeinträchtigung zu finden. Es gab ältere Menschen, die noch die Brailleschrift erlernt haben. Auch wenn es nur war, damit sie wieder jassen konnten. Gerne erinnere ich mich auch an einen Klienten zurück, der wegen seiner Sehbeeinträchtigung eine schwere Depression hatte. Nach anderthalb Jahren hat er Tritt gefasst und wieder Freude am Leben verspürt. Das sind die wirklich schönen Momente im Leben einer Sozialarbeiterin.
Umgekehrt gab es sicher auch frustrierende Situationen. Welche?
(lacht) Ja, wo gibt es die denn nicht..?! Glücklicherweise überwogen aber die freudigen Momente. Frustrierend fand ich es beispielsweise, wenn Klientinnen oder Klienten sich einfach weigerten, etwas auszuprobieren. Ein Hilfsmittel zum Beispiel. Ich musste mir dann einfach sagen, dass die Leute noch nicht bereit waren, dass sie vielleicht später nochmals kommen, wenn der Schuh dann wirklich drückt. Ich musste akzeptieren, dass das ihre Entscheidung ist. Das kann frustrierend sein, aber zwingen konnte und wollte ich sie nicht…
Sie sind vom Fach und selbst betroffen: Welche Hilfsmittel und welche Beratungen nehmen und haben Sie selbst in Anspruch genommen?
Als ich als Jugendliche meine Sehkraft verlor, wandte ich mich an eine Berufsberatung und an die IV für entsprechende technische Hilfsmittel. Heute benutze ich Sprachausgaben, die Brailleschrift und einen Scanner. Und natürlich meinen Blindenführhund. Schon seit 40 Jahren verlasse ich mich auf die Hilfe von Hunden. Zudem nutze ich den weissen Langstock und natürlich das iPhone. Das Mobiltelefon ist schon so selbstverständlich Teil meines Lebens geworden, dass ich gerne vergesse, wie wertvoll diese Hilfe ist.
Angenommen Sie könnten etwas am Schweizer Sozialsystem in Bezug auf Sehbeeinträchtigung sofort ändern, was wäre das?
Ich würde das Gärtlidenken abschaffen. Für mich stand immer die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Vordergrund: Wir können alle voneinander profitieren!
Letztlich hilft das den Klientinnen und Klienten und ihren Angehörigen, wenn wir Fachpersonen Synergien nutzen.