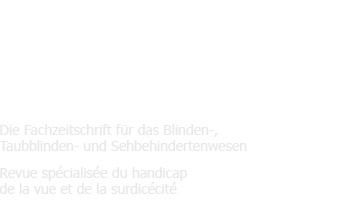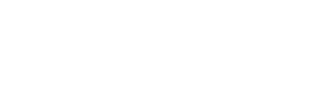100 Jahre Schulgeschichte am Beispiel Sonnenberg
Vom Wandel der Blindenschulen zur inklusiven Bildung


Ein Jahrhundert Wandel: Vom einstigen Blindenheim zur modernen heilpädagogischen Bildungseinrichtung – das Kompetenzzentrum Sehen, Verhalten, Sprechen Sonnenberg in Baar feiert 2025 sein 100-jähriges Bestehen. Exemplarisch für Blindenschulen in der Schweiz zeigt es eindrucksvoll, wie Integration und Diversifizierung das Gesicht der Bildung verändert haben.
Von Michel Bossart, externer Autor, Künzlerbachmann Verlag AG
Im Jahr 2025 feiert das Kompetenzzentrum Sehen, Verhalten, Sprechen Sonnenberg in Baar sein 100-jähriges Bestehen. Mitbegründer Prof. Jost Troxler würde sich verwundert über die Entwicklung die Augen reiben: 1906 war er zusammen mit dem Amtsarzt Laurenz Paly federführend, als Luzerner Bürger und Politiker mit Hilfe der Baldegger Schwestern den Blinden-Fürsorge- Verein Innerschweiz BFVI gründeten. In den allerersten Vereinsstatuten stand unter Vereinszweck: «Beschaffung von Mitteln zur Errichtung einer Blindenanstalt für alleinstehende oder aus anderen Gründen der Fürsorge bedürftige Blinde des Kantons Luzern». 1921 wurde das Blindenheim bei der Waldegg in Horw und 1925 die Schule für blinde Kinder der Zentralschweiz am Sonnenberg in Fribourg, eröffnet. Der Sonnenberg war damals – im Gegensatz zu heute – eine internatsähnliche Einrichtung, in der die blinden Kinder ihre Schulzeit verbrachten und nur drei- bis viermal im Jahr nach Hause durften. Thomas Dietziker, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Sonnenbergs sagt: «Wenn immer möglich, bleiben die Kinder heute in ihrem familiären Umfeld und werden von Fachpersonen einer spezialisierten Organisation entsprechend ihren Bedürfnissen begleitet und in ihrer sozialen Integration unterstützt.»
Es gab also einen Wandel von spezialisierten Internatsschulen für blinde Kinder hin zur aktuellen Situation, in der wie im Sonnenberg ein Kompetenzzentrum entstanden ist, das integrative und separative Sonderschulung, Beratung und Unterstützung sowie therapeutische Leistungen in verschiedenen Förderbereichen anbietet. Das 100-jährige Jubiläum des Sonnenbergs ist Anlass, diesen Wandel exemplarisch zu beleuchten.
Historische Entwicklung der Blindenschulen
Wurden blinde Kinder ursprünglich in eigens für sie errichteten Einrichtungen von sehenden Kindern getrennt, kam es ab Ende der 1980er Jahre zu einem radikalen Paradigmenwechsel: «Die Trennung war nicht mehr selbstverständlich», erklärt Dietziker. Blinde und sehbeeinträchtigte Kinder sollten nun so weit wie möglich in Regelklassen integriert werden. «Ich finde das richtig», fügt er hinzu. Doch die Integration blinder und sehbehinderter Kinder in Regelklassen sei für die betroffenen Lehrpersonen bis heute nicht immer einfach, gibt Dietziker zu bedenken. «Alle sind gefordert, viele leider auch überfordert, weil ihnen das spezifische Knowhow und eine fachkompetente Begleitung fehlen», sagt er. Damit die Integration gelingen kann, müssen spezialisierte Organisationen beratend, begleitend und unterstützend hinzugezogen werden, und es muss für die spezifischen Bedürfnisse des betroffenen Kindes spezialisiertes Fachpersonal zur Verfügung stehen. Diese Unterstützungsmassnahmen sind nicht nur für die betroffenen Kinder bedeutend, sondern auch für das begleitende Personal der Regelschule, denn überforderte und überlastete Lehrerinnen und Lehrer fallen häufiger aus. «Integration ist dann sinnvoll, wenn für Kinder und Jugendliche mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine gleichberechtigte Teilhabe am Unterricht ermöglichen, absolute Barrierefreiheit besteht und auch der Zugang zu Informationen jederzeit gesichert ist.»
In den 1970er Jahren wäre eine Erweiterung der Institution Sonnenberg in Freiburg notwendig geworden. Da aber das Bundesamt für Sozialversicherungen verlangte, dass ein Zentralschweizer Verein auch einen Standort in der Zentralschweiz haben müsse, machte sich der BFVI auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück und wurde im zugerischen Baar fündig. 1981 wurde die neue Schule eingeweiht. «Damals war die Schule noch ausschliesslich für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung reserviert», sagt Dietziker. Das Einzugsgebiet der Institution ging bis in die Ostschweiz, ja sogar Kinder aus dem österreichischen Vorarlberg wurden im Sonnenberg unterrichtet. Neu wurde auch eine Tagesschule für Kinder aus der Zentralschweiz angeboten.
Ab 1986 begann die Aufbauarbeit im Bereich der heilpädagogischen Früherziehung und ab 1987 wurde das Personal im Rahmen von internen Weiterbildungen für die Low Vision-Rehabilitation sensibilisiert. 1990 startete der Beratungs- und Förderdienst. «Dieser mobile Dienst ermöglichte es, blinde und sehbeeinträchtigte Kinder mit geringerem Betreuungsbedarf zu Hause im Alltag zu unterstützen.»
Kann man heute im Vergleich zu 1990 von einer inklusiven Beschulung sprechen, Herr Dietziker?
«Nein. ‹Inklusiv› ist ein viel strapaziertes Schlagwort; bis zur Inklusion ist es aber noch ein weiter Weg. Hier im Sonnenberg sprechen wir von ‹integrativer Sonderschulung›. Das Kind besucht die Regelschule und erhält von uns jene zusätzliche Unterstützung, die es benötigt, um den schulischen Alltag bewältigen zu können.»
Was ist denn ‹inklusiv›?
«Wenn alle Kinder am gleichen Ort unterrichtet würden, wenn niemand mehr ausgeschlossen würde, wenn der Zugang zu Bildung für alle unabhängig ihrer besonderen Situation und Bedürfnisse gewährleistet wäre und absolute Barrierefreiheit bestünde, dann wäre das ‹inklusiv›.»
Keine klassische Blindenschule mehr
Bis zur tatsächlichen Diversifizierung hat es im Sonnenberg bis ins Jahr 2000 gedauert. Aus der Blindenschule wurde das Heilpädagogische Schulund Beratungszentrum. Die erste Klasse mit Schülerinnen und Schülern mit Sprach- und Verhaltensthematiken startete 2001. 2008 wurden zum ersten Mal mehrfachbeeinträchtigte Kinder unter dem Namen «Sehen Plus» beschult. Heute ist die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit im Sonnenberg kleiner, denn viele werden integrativ in Regelschulen an ihrem Wohnort beschult und begleitet. Häufiger trifft man Kinder und Jugendliche mit einer Seh- und Mehrfachbeeinträchtigung an oder, in Klassen des Bereiches Verhaltens- und Sprachpädagogik, mit Verhaltensthematiken, psychischen Erkrankungen oder Autismus. Darüber hinaus bietet der Sonnenberg ein breit gefächertes Therapieangebot. «Der Sonnenberg ist heute definitiv keine klassische und reine Blindenschule mehr», sagt der Institutionsleiter. Das sei auch nicht mehr nötig, denn die betroffenen Kinder können oftmals die Regelschule besuchen, in ihrem gewohnten Umfeld leben und dort die Förderung erhalten, die für sie sinnvoll und zielführend ist. «Sinnvoll ist auch, wenn teilintegrative Lösungen angeboten werden können. Kinder und Jugendliche verbringen dann den Alltag in der Regelschule und erhalten zusätzlich spezifische Unterstützung an der Sonderschule», erklärt Dietziker. Doch bis zum heutigen Stand der Diversifizierung hat es viel Zeit und Aufbau von Expertise gebraucht. «Wir als Sonnenberg-Team mussten ein neues Selbstverständnis entwickeln, das über den Themenschwerpunkt ‹Sehen› hinausging. Wir mussten uns unsere neue Identität mit einer breiteren Ausrichtung verinnerlichen. Das war ein jahrelanger Prozess», erinnert sich Dietziker und zeigt sich mit dem Verlauf zufrieden: «Der Sonnenberg versteht sich heute nicht nur als Sonderschule, sondern als Teil des Schulsystems mit spezifischen Aufgaben und hoher Fachlichkeit in verschiedenen Themenfeldern.»

Wandel in Ausbildung und Struktur
Auch die Ausbildung der Lehrkräfte hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark verändert, um mit den gesellschaftlichen Anforderungen Schritt zu halten: Lange mussten Lehrerinnen und Lehrer nach Deutschland gehen, um Sonderpädagogik im Förderschwerpunkt «Sehen» zu studieren. Dietziker erklärt: «Ein klassischer Werdegang heute ist, dass sich eine ausgebildete Lehrperson für die Arbeit mit beeinträchtigten Kindern interessiert und mit einer befristeten Bewilligung bei uns anfängt. Diese ist maximal drei Jahre gültig. Wenn die Lehrperson sich für die Aufgabe als schulische Heilpädagogin eignet, muss sie innerhalb dieser drei Jahre ein berufsbegleitendes Masterstudium in schulischer Heilpädagogik an einer Hochschule in Angriff nehmen. Dieses dauert je nach Hochschule sechs bis zehn Semester.» Waren Heilpädagogik und Sozialpädagogik im Sonnenberg bis vor kurzem noch in zwei getrennten Bereichen organisiert, wachsen sie heute immer mehr zusammen: «Vieles wird gemeinsam abgedeckt, entsprechend eng und intensiv ist die Zusammenarbeit. Therapien werden teilweise in den Unterricht integriert. Wir haben gemerkt: Wenn wir im ständigen Austausch sind, funktioniert es viel besser. So werden Kinder optimal betreut und gefördert», sagt Dietziker.
Um all diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, mussten auch die Räumlichkeiten angepasst werden. So wurde 2008 das Schulgebäude aufgestockt, 2013 ein zusätzliches Schulhaus gebaut, das seit 2023 bereits wieder um ein Geschoss erweitert ist. Es wurden Räume zugemietet und die Schule im Autismusbereich teilweise ausgelagert. Dietziker sagt dazu: «Für die heutigen Bedürfnisse benötigen wir ganz andere Räumlichkeiten. Baute man 1981 noch eine Art ‹Biotop› für eine einzige Gruppe mit einer einzigen definierten Beeinträchtigung, so sind die Bedürfnisse heute halt ganz anders.»
Jubiläumsjahr mit vielen Höhepunkten
100 Jahre Sonnenberg: Die einstige Blindenschule in Fribourg gehört zwar der Vergangenheit an, das Jubiläum wird aber trotzdem oder gerade deshalb gebührend gefeiert. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto «Wir feiern 100 Jahre Geschichten, Träume und Erlebnisse». Am 13. und 14. Juni 2025 finden Tage der offenen Tür und die offizielle Jubiläumsfeier statt. «Das ganze Jahr über wird es Veranstaltungen für Kinder, Mitarbeitende, Fachleute, die Bevölkerung und alle Interessierten geben», verspricht der Geschäftsführer.
Blindenschulen in der Schweiz
– CPHV, Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue, Lausanne
– Kompetenzzentrum Pädagogik | Therapie | Förderung (KPTF), Münchenstein
– Schule Fokus Sehen (SFS), Zürich
– Sonnenberg, Kompetenzzentrum Sehen Verhalten Sprechen, Baar
– Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche, Zollikofen
– Stiftung visoparents, Zürich
– Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, Langnau am Albis
Weitere Informationen unter: www.szblind.ch/kontakt/schulen